
Kunst bist du!
Dr.
Peter Funken
Der Text beschreibt
Stefan Krüskempers Gestaltungen für die Zürich-Schule
in Berlin-Neukölln und erschien in der gleichnamigen
Publikation »Ene, mene, muh, und Kunst bist du!« zum
Kunst-am-Bau Projekt (2010).
Kunst
vor Ort
Helga
de la Motte-Haber
Den Katalogbeitrag
schrieb Helga de la Motte-Haber anlässlich der Fertigstellung
der Klanginstallation AIR BORNE. Erschienen ist der Text
in der Publikation »AIR BORNE« im verlag für
integrative kunst, 2006.
Philosophischer
Parkspaziergang
Reinhard
Knodt
Der City-Point
wäre schlecht verstanden und verkürzt begriffen,
wenn wir ihn einfach als Einkaufsparadies bezeichnen
würden. Er ist viel mehr, und man versteht unsere
Zeit nicht, wenn man sich nicht - kunstgestützt, wie wir das hier jetzt
versuchen wollen, ein paar Gedanken über
seine Herkunft macht (2005).

Bürger
machen Kunst
Stefan Krüskemper, María
Linares, Kerstin Polzin
Die Citizen Art Days 2012 zeigten
deutlich, wie viele Menschen das starke Bedürfnis haben,
zu den Fragen ihrer Stadt bzw. dem öffentlichen Raum über
Teilhabe, Differenz und Miteinander zu arbeiten.
Wie
die Kunst die Bürger
gewann
Stefan Krüskemper
Bericht über
einen experimentellen Workshop in Berlin zum Verhältnis der Beteiligten
bei der Umsetzung von Kunst im öffentlichen Raum publiziert in »kunststadt
stadtkunst« Heft 57, 2010.
Public
Art Practice in Berlin
Christina
Lanzl
Berlin ranks high
among the world’s urban centers. What makes this
city so special, so worth living in or visiting? Perhaps
it is the rewarding experience of feeling a sense of
place ... (2009).
Mit
Sprachsinn und Raumverstand
Stefan Krüskemper,
Der Artikel erschien
2009 in der Berliner Zeitschrift für Kunst im Öffentlichen
Raum »Kunststadt - Stadtkunst«, Heft 56. Ausführlich
beschrieben ist das Wettbewerbsverfahren und die Jurysitzung
zur Kunst am Bau für das Carl Gustav Carus Universitätsklinikum
in Dresden.
Kunst
als Kompromiss
Stefan Krüskemper, Patricia
Pisani
Fokus dieses Texts
ist die Jurysitzung eines Kunstwettbewerbs in Berlin,
die durch den Konflikt zwischen Nutzern und Fachpreisrichtern
viele generelle Fragen aufwarf. Erschienen ist der
Artikel in der Zeitschrift
über Kunst im Öffentlichen Raum »Kunststadt
- Stadtkunst«, Ausgabe 55, 2008.
Keine
einfache Rechenaufgabe
Martin
Schönfeld
Kunst für
einen Universitätsstandort zu entwickeln, gehört
zu den sehr attraktiven Aufgaben der Kunst im öffentlichen
Raum. Erschienen ist der Artikel in der Zeitschrift
über Kunst im Öffentlichen Raum »Kunststadt
- Stadtkunst«, Ausgabe 53, 2006.

Wo
kommt eigentlich die Kunst her?
Maria Linares, Stefan Krüskemper
Maria Linarres im Gespräch
mit Stefan Krüskemper über den Begriff der Partizipation
und Emanzipation. Erschienen ist der Text in »Ene,
mene, muh, und Kunst bist du!« (2010).
AIR
BORNE
Jörg Amonat,
Karlheinz Essl, Stefan Krüskemper
Während der Realisierungsphase
der Klanginstallation im Aerodynamischen Park in Berlin
Adlershof wurde das Gespräch der Künstler aufgenommen
und transkribiert. Erschienen ist der Text in der Publikation »AIR
BORNE« im verlag für integrative kunst, 2006.
Alles
im grünen Bereich
Jörg Amonat,
Stefan Krüskemper, Michael Schneider, Johannes
Volkmann
Ein Gespräch
zwischen Michael Schneider und dem buero für integrative
kunst über die Umsetzung des Projekts »parkTV« vor
Ort. Erschienen ist der Text in der Publikation »parkTV
- Alles im grünen Bereich« im verlag für
integrative kunst, 2005.
Heute
ist ein schöner Tag
Jörg Amonat, Anne Eberle,
Stefan Krüskemper
Das Interview mit
der Erwerbslosen Anne Eberle entstand für die Ausstellung »Science
+ Fiction« auf Einladung der Künstler Dellbrügge
und de Moll für ihre Wissens-Installation »Wild
Cards«, 2003.
Positionen
und Tendenzen
Christina Jacoby, Stefan Krüskemper,
Heidi Sadlowski
Auszug aus einem Interview
von Christina Jacoby mit Heidi Sadlowski und Stefan Krüskemper
zu ihrem Projekt »Arbeit über Arbeit«.
Erschienen ist der Text in der Publikation »Positionen
und Tendenzen - goes public«, 2001 im Verlag für
moderne Kunst, 2001.

Politische
Aspekte von Kunst im urbanen Raum
Stefan Krüskemper
Der Vortrag war
am 5. Februar 2009 im Haus Huth der Daimler Contemporary
im Rahmen der Veranstaltung »Vom Reiterstandbild
zum Graffiti« zu hören. Beleuchtet wurde an
diesem Abend die Entwicklung der Kunst im öffentlichen
Raum unter dem Aspekt ihrer politischen Aussagefähigkeit
und Wirkungsfähigkeit.
Kunst
im öffentlichen Raum
Dr.
Anne Marie Freybourg
Zur Eröffnung
der Klanginstallation
»AIR BORNE« am 25. Oktober 2006 hielt
Dr. Anne Marie Freybourg als Mitglied der Jury die
nachfolgende Rede.

Der
Traum vom Raum
Stefan Krüskemper
Während eines
Arbeitsaufenthalts in der Galerie »Autocenter« (Lovelite)
in Berlin Friedrichshain entstand dieses Essay über
die Kommerzialisierung von Stadt und ihren neuen Tempeln,
den Einkaufsmalls. Erschienen ist der Text in der Publikation »parkTV« im
verlag für integrative kunst, 2005.
The
Matrix has you
Stefan Krüskemper
Das Essay ist
ein Resümee des Projektes »Arbeit über
Arbeit«, zu dem Soziologen, Philosophen und Künstler
eingeladen waren, um über einen heutigen Arbeitsbegriff
zu diskutieren. Erschienen ist der Text in den Publikationen »Arbeit über
Arbeit«, 2001 und »Log.in - Netz, Kunst,
Werke« im Verlag für moderne Kunst, 2001.

Tätig
werden. Ein Spiel.
Jörg Amonat, Stefan
Krüskemper
Das Experiment einer
direkten Umsetzung eines dokumentarischen Videos in eine
Print-Publikation, zeigt der Beitrag für das Buch »Arbeit
und Rhythmus«. Das Buch erschien im Wilhelm Fink
Verlag München, 2009.
Team
Fiction
Stefan Krüskemper
Der Text ist gleichzeitig
Reisebericht und Textvorlage für die gleichnamige
Theaterperformance, die in Cali und Berlin aufgeführt
wurde. Erschienen ist das Stück in Gesprächsform
in der Publikation »The Intricate Journey« im
Verlag der Neuen Gesellschaft für Bildende Kunst,
2007.
Arbeit
simulieren
Stefan Krüskemper
Diese Textarbeiten
stehen stellvertretend für eine Reihe Miniaturen mit
besonderen Formen der Veröffentlichung. In knappester
Form vermitteln diese Sätze Erkenntnis über eine
komplexe Fragestellung. Erschienen sind diese Textarbeiten
in der Ausstellung »KunstRaumFranken« im Kunsthaus
Nürnberg als Leuchtkästen, 2001.
|
AIR
BORNE
Jörg Amonat, Karlheinz
Essl, Stefan Krüskemper
Amonat: Mich
interessiert dein Entwurfsansatz, Stefan. Du hattest geäußert,
dass am Anfang der gedanklichen Auseinandersetzung das neu
entstandene Café im ehemaligen Motorenprüfstand
eine Rolle spielte.
Krüskemper: Ich
hörte, dass es aus dem StudentInnenparlament heraus die
Idee gab, ein selbstverwaltetes Café als Treffpunkt und
Veranstaltungsraum zu etablieren. Aber mir war schnell klar,
dass es in einer solchen Wettbewerbssituation nicht funktionieren
kann, sich als Künstler in den Prozess einzubringen.
Visuell ist der Aerodynamische Park ja absolut
interessant, mit seiner zeitgenössischen Architektur, den
gelungenen Gebäuden von Volker Staab oder den starken, fast
expressiv wirkenden Figuren der technischen Baudenkmale. Der
Trudelturm ist zum Beispiel als Skulptur so außerordentlich,
dass für mich daneben in Konkurrenz nichts vorstellbar war.
Mit zunehmender Beschäftigung während
der Wettbewerbsphase stellte sich vielmehr das technische Geräusch
als ein besonderes Merkmal des Ortes, damals wie heute, heraus.
Es lag dann nahe, das Thema »Klang« aufzugreifen
und hier das integrative Moment zu suchen.
Amonat: Als
eine Möglichkeit, auf die Geschichte des Ortes einzugehen,
also die Vergangenheit mit einzubeziehen. Es ist immer eine Frage
bei der sogenannten Kunst im öffentlichen Raum, was man
erreichen möchte. Man kann durch eine künstlerische
Arbeit die Aufenthaltsqualität eines Ortes verbessern oder
einen thematischen Aspekt verdeutlichen. Es gibt da viele Ebenen,
die sich durchdringen können. Der Ort muss in jedem Fall
eine Qualität bekommen, die so vorher noch nicht da war.
Darin sehe ich die große Herausforderung und Aufgabe des
Künstlers, sich mit dem Ort auseinanderzusetzen und aus
diesem heraus die Arbeit zu entwickeln.
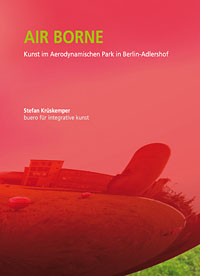 |
Erschienen in: Air Borne,
verlag für integrative kunst, Berlin 2006.
ISBN-10: 3-00-018996-3
|
Krüskemper: So
wie »Air Borne« jetzt angelegt ist, bringt die Arbeit
für die Aufenthaltsqualität eine zusätzliche Ebene
im Sinne einer medialen Erweiterung des Raums ein. Trotz vordergründig
technischer Mittel ist es eine emotionale Ebene, die es ermöglicht,
mehr über den Ort zu erfahren und ihn durch die Verdichtung
des Atmosphärischen anders zu erleben. Ohne irgendwelche
Hinweisschilder oder Informationstafeln zur Geschichte. Der Schlüssel
für diese Arbeit ist eine künstlerische Ebene aus Klang
und Text, die in Form von ganz komprimierten Narrationen die
Identität des Ortes nahe bringt und die verstummten Gebäude
wieder zum Sprechen bringt.
Amonat: Auf
was beziehen sich die Texte?
Krüskemper: Die
Texte beziehen sich aus ihrer räumlichen Position auf dem
Gelände heraus auf Zeitschichten. Sie beziehen sich auf
das Heute, die Nachkriegszeit und zurück bis zur Eröffnung
des Flughafengeländes. Es sind zunächst situative Atmosphären
aus einer historischen Dimension heraus beschrieben. Zeitlich
gesehen ist die früheste Position »Der Himmel voller
Verrücktheiten. Sonntags Applaus«. Das ist sozusagen
ein Blick in das Jahr 1909, zur Eröffnung des Flughafens
Johannisthal. Keiner wusste damals eigentlich so richtig, wie
und warum man fliegen kann, wie es funktioniert. Alle bauten
völlig verrückte Flugapparate, aber nur die Hälfte
davon flog wirklich, die anderen brachen zusammen. Was für
Momente für die Phantasie! Der Franzose Hubert Latham musste
wegen eines Fluges 150 Mark Strafe wegen »groben Unfugs« zahlen.
Die Leute kamen zu Zehntausenden aus der Stadt, um sich alles
begeistert anzusehen, ein Sonntagsvergnügen. Der Text ist
also ein verdichtetes Moment dieses Bildes. Eine Narration en
miniature.
Diese Texte reißen aber immer auch
Geschichten von Menschen an, selbst wenn technische Begriffe
als Bindeglied zum Ort in den Vordergrund gestellt sind. Wenn
also an einer Stelle »Dem Druck nachgeben« steht
oder an einer anderen »Dem Druck nicht nachgegeben haben«,
dann ist aus technischer Sicht die Beziehung zum Windkanal und
zum Trudelturm hergestellt. Ich stellte mir aber meist die Menschen
vor, die da zu unterschiedlichen Zeiten arbeiteten. Hatten sie
zum Beispiel in der Vorkriegszeit dem Druck durch das Militär
nachgegeben, gegen die internationalen Verträge geheim Flugzeuge
für das Militär entwickelt, wie es Ossietzky in der »Weltbühne« über
Johannisthal beschrieb? Ich fragte mich aber auch, welche Sätze
für mich heute eine Relevanz haben.
Auf dieser emotionalen Ebene kommt der Klang
mit ins Spiel. Karlheinz, du würdest den Begriff »Narration« aus
diesem Blickwinkel etwas anders interpretieren.
Essl: Ich
sehe ihn zunächst einmal als Metapher. Erzählung bedeutet
ja auch immer etwas Teleologisches, etwas, das immer auf ein
Ziel gerichtet ist. Und bei unseren Klangstücken gibt es
in diesem Sinn keine Absicht. Wie die Geräusche, die ständig
an diesem Ort vorhanden sind, bereits einen Teil der Arbeit darstellen
und deshalb auch nicht intentional sind.
Es ist ein ganz wichtiger Ansatz für
die Rezeption der klanglichen Seite, dass wir nicht abgeschlossene
Geschichten erzählen, die die Leute in eine Richtung verstehen
müssen, sondern dass wir im Grunde ein Environment anbieten,
das die Leute anregt, ihre eigene Geschichte dazu in Beziehung
zu setzten.
Krüskemper: Die
Stille als eigenständiges Element der Klangstücke,
die im Sinne von Cage Raum gibt für die authentischen Geräusche
des Ortes, ist in der Verbindung mit den Texten eine ganz wichtige
Dimension der Arbeit. So entsteht, denke ich, eine dauernde Präsenz
und Erwartung auf dem Gelände. Das Fortschreiben der Geschichten,
des eigenen Films, findet dann nämlich bei den Leuten selbst
statt. Die Stille ermöglicht aber auch erst die Frage: Was
hör’ ich denn da jetzt eigentlich, was kann das sein?
Gehört dieser Ton zum Ort oder ist er Teil eines Klangstücks?
Das wird sich am Ort nicht mehr entscheiden lassen – beide
Klangebenen fallen untrennbar in einem Klang-Ort-Geschehen zusammen.
Amonat: Die
gegenwärtigen Geräusche und Klänge verbinden sich
mit dem ausgewählten Archivmaterial. Genau diese Schnittstelle,
die sich da an einer Station zwischen Vergangenheit und Gegenwart
bildet, finde ich spannend. Problematisch könnte es sein,
nachzuvollziehen, dass das Archivmaterial aus der Geschichte
des Ortes stammt, denn durch die Software generiert sich das
zu einem autonomen Musikstück.
Essl: Nein,
denn es blitzt doch immer wieder der Bezug zum Archivmaterial
durch. Zum Beispiel gerade bei jenem Material, das stark semantisch
aufgeladen ist, z.B. Marlene Dietrichs Lied »Unter den
Linden«. Über weite Strecken hört man einen reinen
Klangrausch, eine autonome Komposition und plötzlich blitzt
da ein Fetzen oder eine Phrase aus dem Original durch – damit
wird der Bezug dann auch deutlich. Und dann denkt man beim Hören:
Was ich gerade gehört habe, stammt ja aus diesem Stück.
Krüskemper: Diese
Stelle bezieht sich übrigens auf die Position »An
die Liebe unter den Linden denken«. Dazu muss man wissen,
dass es aus der Aufgabenstellung heraus den Wunsch gab, eine
Verbindung dieses Campus zur Humboldt-Universität in der
Innenstadt Unter den Linden sichtbar werden zu lassen. Umgesetzt
ist es hier mit diesen Liedfragmenten, in denen es um Erinnerungen
geht. Diese Position trägt vom konkreten Ort weg und führt
in die Mitte Berlins. Es ist eine Anregung, sich hinweg zu träumen.
Essl: Aber
wieder zu deiner Frage des Archivmaterials: Ich glaube generell,
dass wir als Künstler nicht eindimensional arbeiten, sondern
immer in vielen Schichten. Eine Einstiegsmöglichkeit in
die Komposition ist sicherlich die über das Wissen und die
mit der Arbeit zusammenhängende konzeptionelle Basis. Wenn
man sich damit beschäftigt, kann man mit diesem Wissen viel
Freude haben, beim Hören neue Geheimnisse zu entdecken.
Die andere Ebene ist eine ganz pragmatische, vom Hören ausgehende.
Was höre ich hier? Egal, ob das Marlene Dietrich ist oder
etwas anderes. Da erklingt etwas, das zu mir spricht, was mich
berührt oder vielleicht auch kränkt und mich zu einer
Auseinandersetzung nötigt.
Amonat: Das
Bedürfnis, sich etwas zu erschließen, ist ja bei Vielen
da: Die Leute versuchen sich einen Zugang zu verschaffen. Es
ist auch immer wieder zu beobachten, wie unterschiedlich dies
geschieht, ob nun über eine Formel, einen Text, die eigene
Biografie oder eine Atmosphäre. Für Dich, Stefan, scheint
es das Archivmaterial gewesen zu sein. Du hast es gewählt,
um Dir selbst diesen Ort zu erschließen. Dann hast Du das
Material bearbeitet und durch diese Bearbeitung entstanden wieder
viele neue Aspekte. Dieser Prozess ist sehr individuell, und
die Studenten, die da auf der Wiese liegen, müssen das nicht
nachvollziehen können, um die Arbeit zu »verstehen«.
Sie müssen jedoch einen Impuls bekommen für genau jene
Verbindung der Arbeit mit dem Ort, der sie spüren lässt,
dass diese Arbeit sich nur hier befinden kann und nicht woanders.
Die eigenen, wiederum ganz individuellen Assoziationsketten stellen
sich dann von ganz alleine ein. Die können sich dann auch
von allem lösen, was dieser Arbeit erklärend und theoretisch
beigefügt wird. Das ist der subjektive Raum des Einzelnen.
Doch in der Verbindung zum Ort muss die Arbeit kollektiv erfahrbar
sein.
Krüskemper: Ein
Archiv ist eine besondere Form der Erinnerung. Die von mir recherchierten
Materialien stammen alle aus dem Deutschen Rundfunkarchiv, das
die Bestände des Fernsehens der DDR, das nach dem Krieg
auch auf dem Johannisthaler Gelände in Berlin-Adlershof
beheimatet war, zusammengeführt hatte. Das Archiv befand
sich also ganz konkret vor Ort, bis es 2000 nach Babelsberg verlegt
wurde. Recherchiert habe ich in Materialien aus Fernseh- und
Radioproduktionen, aber vor allem war das Geräuscharchiv
mit seinen unzähligen Aufnahmen – zum Beispiel zum
Thema »Fliegen« – außerordentlich interessant.
Die Bandbreite in dieser Kategorie reicht von historischen Schallplattenaufnahmen
alter Flugapparate bis zu Innenaufnahmen moderner Jets. Alles
ist noch auf Tonbändern zu hören. Aber auch ganz andere
Kategorien, wie Windkanalaufnahmen, Zischgeräusche technischer
Großanlagen oder Lieder des dort nach dem Krieg stationierten
Wachregiments »Feliks Dzierzynski« habe ich gesichtet
und entschieden, ob sie in die Arbeit aufgenommen werden können.
»Air Bornes« klanglicher Teil
basiert auf dem Archiv, und doch stehen technische Aufzeichnung
und Erinnerung in einem gewissen Widerspruch. Denn Erinnern ist
auch ein kreativer Vorgang, bei dem ich immer wieder ganz neue
Bilder erschaffe. Dieses Suchen und Erschaffen von neuen Bildern
war von Anfang an da. Und aus diesen Gedanken heraus ist die
Komposition – im Gegensatz zu einem Radio-Feature oder
Hörstück – bewusst auch als etwas gedacht, dass
sich immer wieder eigenständig aus dem Vorhandenen entfaltet.
Immer wenn die Komposition ins Autonome geht, entsteht das Bild
einer »Erinnerung«, die es so nie gab. Man könnte
diesen neuen Klang vielleicht eine nachempfundene Erinnerung
nennen.
Das ist eine Antwort auf deine Frage zur
Nachvollziehbarkeit. Die andere Antwort kreist um den Punkt:
Was ist eigentlich Klang im öffentlichen Raum? Gibt es da
eine Art Genealogie? Und da kommt der Zufall als strukturgebendes
Prinzip mit hinein, dieses Fragmentarische, individuell nicht
Greifbare, dieses Gefühl, über einen Platz zu gehen,
nur hier und da etwas aufzuschnappen und die Situation doch als
Ganzes, als eine Atmosphäre zu begreifen.
Essl: Hättest
Du es lieber pädagogisch aufbereitet, Jörg?
Amonat: Nein,
natürlich nicht. Das wäre dann auch eine sehr schlechte
Arbeit. Ich bemerke nur den Drang der Leute dazu. Der Moment,
indem sie die Tür zu diesem Stück öffnen können,
ist ja wichtig. Dann werden sie »hineingehen« und
sich von Station zu Station bewegen, um sich die Arbeit zu erschließen.
Dann setzt vielleicht ein Aha-Erlebnis ein. Die Suche nach dieser
Tür ist ja immer da, wenn nicht von vornherein die Arbeit
abgelehnt wird. Wenn ich in ein Konzert gehe, weiß ich
ungefähr, was mich erwartet, die Richtung ist gegeben und
ich kann mich darauf einstellen. Diese Arbeit befindet sich in
einem speziellen räumlichen sowie zeitlichen Kontext, sie
muss ganz anders rezipiert werden.
Krüskemper: Weil
mir das wichtig war, habe ich von Beginn an die Ebene der Vermittlung
als Teil der künstlerischen Arbeit mitbedacht. Eine Publikation,
die sowohl die künstlerische Arbeit als auch die Geschichte
des Ortes erläutert, soll unter anderem in den umliegenden
Instituten und der Bibliothek ausliegen. Auch auf die Projektwebsite
wird vor Ort hingewiesen. Um eine vertiefende Möglichkeit
der Auseinandersetzung anzubieten, kann man sich via Internet
auch zu Hause ausgewählte Hörbeispiele anhören.
Aber die Arbeit entscheidet sich natürlich
vor Ort. Es war ein längerer Prozess, bis ich in der Entwurfsphase
eine für mich stimmige Hierarchisierung der Klangebenen
gefunden hatte, die von Karlheinz kompositorisch ausformuliert
wurden. Als Türen waren von Beginn an die sogenannten »Signalklänge« angelegt,
die durch ihre Seltenheit zu etwas Wertvollem werden und neugierig
machen. Als ein typisches Beispiel kommt eine ganz kurze, aber
pure Sequenz aus einer Aufzeichnung einer russischen Bodenstation
vor. Das ist dann ein ganz direkter Einstieg ins Thema »Fliegen«,
der mit dem Text zusammen sofort eine assoziative Szene ergibt.
Vertiefend, aber auch zugleich freier angelegt,
ist dann die Ebene der geflüsterten Klangstücke. Diese
freieren Kompositionen, die ja auf demselben Material der Signalklänge
basieren, sind ganz leise und verweben sich mit der Atmosphäre
des Ortes. Im Gegensatz zum immer wieder überraschenden
Signalklang erfordern diese »Flüsterstücke« ein
aktives Hören und bedürfen der Exploration. Die oft
lang anhaltende Stille, über die wir ja schon sprachen,
empfinde ich als eine eigenständige dritte Klangebene.
Essl: Die
Signale wurden in der Arbeit immer wichtiger.
Amonat: Sind
diese Signale der Beginn eines neuen Themas?
Essl: Nein,
sie sind einfach wie kostbare Perlen zwischen den Schutt gemischt,
wenn man so will.
Amonat: Dieses
Material wird doch aber auch durch die Software generiert.
Essl: Ja,
es kommt aber immer wieder in Form dieser sehr kurzen Signale
vor.
Amonat: Das
sind so 20 oder 56 Sekunden.
Essl: Nein,
die Signale sind noch kürzer. Da sagt zum Beispiel eine
Stimme: »Es war ein toller Tag.« Das kommt nur einmal
vor. Aber ich glaube, jedes Mal, wenn man es hört, konstruiert
man sich dazu eine Bedeutung.
Also mein Ansatz ist, immer mindestens zwei
Eingänge anzubieten: den für den Wissenden – für
Leute wie Komponisten oder Spezialisten. Und dann einen Eingang
für diejenigen, die sich ganz offen der Arbeit nähern
und sich darauf einlassen wollen. Mein Anspruch ist, dass es
auch diejenigen, die kein Wissen haben, direkt treffen und anziehen
soll. Und meine Erfahrung auch als Live-Musiker ist, dass dies
bei fünfzig Prozent der Leute der Fall ist. Die brauchen
keine Spezialisierung, die müssen nur bereit sein, sich
dem Klang hinzugeben und sich ihm auszusetzen.
Und dadurch, dass der Klang eben fremd und
nicht vertraut ist, sind die gewohnten Beurteilungskriterien
außer Kraft gesetzt. Die Hörer können ihn nicht
mehr mit den Maßstäben der Popmusik oder der Klassik
messen, sondern sie stehen vor dem Ganzen wie vor einer fremden
Sprache. Nun gibt es zwei Möglichkeiten. Man sagt, ich lehne
das ab, das ist mir zu steil, ich verstehe davon nichts, dann
geht die Klappe zu. Oder die Klappe geht eben auf, und da kann
dann viel passieren.
Krüskemper: Ich
fand es interessant, dass bei Gesprächen im Vorfeld einige
Personen ihre Tür zu der Arbeit über die Software und
die Mechanik der Zahlen gefunden haben. Ich selbst habe als Nichtmusiker
den Zugang allerdings auch über die Software gefunden, bevor
ich Karlheinz für eine Zusammenarbeit angesprochen habe.
Es zeigte sich, dass die Software im Sinne einer Kompositionsstrategie
wirklich eine Schnittstelle zwischen unterschiedlichen Professionen
bilden kann, also in Form eines partizipatorischen Modells wirkt.
Die Software, die Du jetzt eigens für
den Aerodynamischen Park geschrieben hast, ist ja durch ihre
Benutzeroberfläche sehr klar strukturiert. Aber was passiert
eigentlich konkret in den einzelnen Ebenen und Bereichen?
Essl: Das
Herzstück des »AIR BORNE Generators« ist ein
Art Maschine, die einen bestehenden Klang – ein Sample – in
seine Einzelteile zerlegt und aus diesen Einzelteilen, die zum
Teil sehr kleine Klangkörner von wenigen Millisekunden Dauer
sind, durch bestimmte Operationen neue Klänge formt. Die
Software ist generativ aufgebaut, das heißt, die Erzeugung
des Klanges erfolgt in Echtzeit auf Grund von Kompositionsalgorithmen,
die sich innerhalb der Zeit verändern. Die Steuerung dieser
Veränderungen erfolgt wiederum über Zufallsgeneratoren,
die allerdings in bestimmten Grenzbereichen operieren, die aber
wiederum vom Zufall abhängen. Es ist ein auf vielen Ebenen
gesteuertes nicht-lineares System, in dem der Zufall wiederum über
den Zufall konturiert wird.
Krüskemper: Du
hast in diesem Zusammenhang von der »Brownschen Molekularbewegung« geredet.
Essl: Die
Brownsche Molekularbewegung steht als Metapher für eine
Spielart des Zufalls, der innerhalb eines bestimmten Wertebereiches
nicht jeden beliebigen Wert annehmen kann, sondern nur abgestufte
Werte aufsuchen kann. Diesem Zufall wohnt eine gewisse Trägheit
inne. Wenn er beispielsweise einmal den Wert siebzig gewählt
hat, dann kann er beim nächsten Mal nicht den Wert siebzehn
wählen, sondern höchstens sechzig. Dieses Prinzip ist
eminent musikalisch, weil dadurch nämlich immer fließende Übergänge
und Bewegungen entstehen, die beim Hören nachvollziehbar
sind.
Krüskemper: Gehen
wir doch die Software der Reihe nach durch. Du hast ganz oben
einen ersten Bereich, wo du auf alle fünfzehn Positionen
bzw. Klangstücke zugreifen kannst und damit die entsprechenden
Samples aus dem Archiv und die jeweiligen kompositorischen Parameter
reinlädst. Direkt daneben gibt es dann eleganterweise den
entsprechenden Subtext dazu, der die narrativen Vorgaben enthält.
Essl: Die
folgende Ebene bezieht sich auf das Ausgangs-Sample selbst und
enthält Anweisungen, wie die daraus gewonnen Klangkörner
strukturiert sind, wie groß sie sind, wie weit sie sich überlappen
können und wie stark sie in ihrer Tonhöhe verändert
werden können.
Krüskemper: Darunter
liegt die dritte Ebene, die du als Herzstück beschrieben
hast.
Essl: Das
sind diese fünf verschiedenen »Granulierer«,
die allerdings nicht alle zur gleichen Zeit laufen. Es läuft
immer der ganze rechte, das ist sozusagen der rote Faden. Dort
wird der Klang auch nicht transponiert, sondern in seiner Originalgestalt
gespielt, auch wenn er in Körner zerlegt ist. Und diese
anderen vier Granulierer, die zum Teil auch das Ausgangs-Material
transponieren können, werden von einem Modul, das ich »conductor«,
Dirigent, nenne, immer wieder zu- und abgeschaltet. Es ergibt
sich dadurch, dass immer wieder eine Schicht dazukommt oder wegfällt
und so fließende strukturelle Verdichtungen und Verdünnungen
entstehen.
Krüskemper: Mir
gefällt so gut daran, dass du über dieses Modul eine
Balance zwischen Referenzklang und freier Komposition gefunden
hast. Kann ich das so vereinfachend sagen? Das hat schon etwas
mit diesem Modul ganz rechts zu tun, das den roten Faden bildet?
Essl: Absolut
ja.
Krüskemper: Und
von dem Herzstück aus kommt man dann in die vierte Ebene
des sozusagen Atmosphärischen, was den entstandenen Klang
noch einmal einfärbt.
Essl: Das
ist so ganz gut beschrieben. Es ist so eine Art Filtersystem,
wo verschiedene Arten von Klangveränderungsprozessen eingesetzt
werden, deren Intensitäten wiederum einstellbar sind. Das
heißt aber, eine jeweils eingestellte Intensität definiert
nur, wie stark die Veränderung maximal sein kann. Innerhalb
dessen gibt es wieder Zufallsoperationen, die das Mischungsverhältnis
dieser Effekte auch zeitvariant ständig ändern. Dieses
Modul zum Beispiel ist ein Bandpass, der das hörbare Frequenzspektrum
begrenzt und nur bestimmte Teile des Spektrums durchlässt,
wodurch der Klang sehr stark reformiert werden kann und zum Teil
völlig unkenntlich wird.
Das letzte Fenster enthält die Optionen
zum Output, wie etwa Länge und Lautstärke der Stücke.
Die Software generiert die Klänge, die dann vor Ort hörbar
werden, als Soundfiles, die von einem eigens dafür entwickelten
MP3-Player im Random-Mode abgespielt werden.
Amonat: Ihr
hattet gesagt, dass ein Stück vier Jahre läuft, also
die Regelstudienzeit eines Studenten an dieser Uni. Gibt es daher
einen Anfang und ein Ende der Komposition?
Krüskemper: Na
ja, das ist zunächst eine Formulierung bei der Vermittlung
der extrem überdehnten Zeitlichkeit von »Air Borne« gewesen.
Auch nach vier Jahren werden Klangkonstellationen neu und unvorhersehbar
bleiben. Dadurch gibt es diesen Moment eines Endes dann gar nicht.
Und auch was ich schon gehört habe, war ja von meiner eigenen
Position auf dem Gelände abhängig, ob ich also gerade
am Hörsaalgebäude oder am großen Windkanal stand.
Bei dieser Zeitangabe ging es darum, dass die Komposition sich
eben als Beziehungskörper sehr langsam entfaltet und sich
damit an die Leute richtet, die vor Ort arbeiten und leben. Es
ist doch auch total spannend, nach vielleicht drei Jahren endlich »Holzzerteilte
Propellerluft atmen« zu hören. Man ist über Jahre
neugierig geworden, was sich klanglich dahinter verbirgt und
was da wohl herauskommen mag. Um seinen Freunden dann zu sagen: »Hey,
ich hab’ es endlich gehört, echt verrückt!«
Essl: Mich
interessiert ja immer der Rezipient. Meine Erfahrung ist, dass
alles, was über die Augen aufgenommen wird, analytisch beurteilt
und bewertet wird. Dies ist der natürliche Vorgang in unserem
kognitiven System. Wenn man Bilder sieht, müssen diese analysiert
werden, um verstanden werden zu können. Ein Beispiel: Das
Baby kommt auf die Welt und alle sagen, es kann ja noch nichts
sehen. Es hat zwar ein voll ausgebildetes Sehorgan, aber es hat
noch nicht gelernt, die Wahrnehmungsreize zerebral zu verarbeiten.
Es muss erst die Bedeutung dessen erlernen, was sich da vor ihm
bewegt. Ist es meine eigene Hand oder die Hand meiner Mutter?
Nähe und Ferne – es ist alles ein Bewertungsvorgang,
der erlernt werden muss. Das Sehen ist also etwas, das wir uns
nach unserer Geburt angeeignet haben; etwas, mit dem wir die
Außenwelt analysieren.
Das Hören dagegen beginnt schon im Mutterleib,
bevor die Wahrnehmung über das Sehen stattfindet. Und da
läuft sehr viel über das limbische System, was heißt,
es geht nicht über den Cortex, wo bewertet und analysiert
wird, sondern sozusagen über das Stammhirn – ich sage
mal – direkt in die Seele. Das Hören ist ein ganz
tief in unserem menschlichen Sein verankerter Sinn. Man kann
sich ihm nicht entziehen. Wenn du etwas nicht sehen willst, machst
du die Augen zu, du kannst aber nur sehr schwer die Ohren schließen.
Deswegen glaube ich auch, dass das Hören mit so starken
Emotionen verbunden ist.
Ich will einem Hörer in meinen Arbeiten
immer etwas anbieten, das soweit offen ist, dass er darin Platz
findet und sich wie in einem Garten bewegen kann. Letztlich möchte
ich akustische Landschaften gestalten, sogenannte »soundscapes«:
auditive Gartenanlagen, die voller Blumen sind, mit Wegen, Wasserläufen
und lauschigen Plätzen, die aber auch ein wenig Unheimliches
bieten, wo es dunkler und moosiger wird. Ich stelle den Leuten
frei, diesen Garten in Besitz zu nehmen und sich darin zu bewegen.
Amonat: Aber
wie begegnest Du dann dem äußeren visuellen Raum?
Deine »soundscapes« sind ja oft, wie im Aerodynamischen
Park, in solche Räume eingebettet. Sind diese für Dich
eher sekundär?
Essl: Nein,
sie sind es nicht, weil diese historischen Bauten mit ihrer starken
Expressivität und ihrer strukturellen Gemeinsamkeit – den
gekrümmten Betonstrukturen von Trudelturm, Windkanal und
Motorenprüfstand – ein geschlossenes System bilden,
welches stark ist. Ebenso stark ist die grüne Wiese und
die darin aufgestellten fünfzehn himbeerroten Ellipsoide,
die wie außerirdische Pilze wirken. Und ich glaube, dass
dies dem Garteneindruck, dieser Idee der Klanglandschaft, sehr
stark entgegenkommt. Man hat den Eindruck eines gewachsenen Gartens
mit vielen Blumen und Beeren.
Amonat: Es
ist das Verständnis, dass alles, was uns auditiv umgibt,
Klanglandschaften mit eigenen Rhythmen sind, die sich auf sehr
unterschiedliche Weise miteinander verweben können.
Essl: Das
ist bei uns eigentlich recht subtil gelöst. Dadurch, dass
die einzelnen Klangstrukturen relativ selten vorkommen und langsam
ein- und ausgeblendet werden, treten die Umweltgeräusche
wieder in den Vordergrund. Dadurch glaube ich, dass man die Außengeräusche
anders wahrnimmt – als Teil der Arbeit selbst.
Krüskemper:
Das Konzept eines Konzerts, das ich in diesem Zusammenhang weiterführend
finde, ist Stockhausens »Sternklang – Parkmusik für
fünf Gruppen«. Innerhalb einer Parklandschaft spielen
verschiedene Gruppen. Die Besucher flanieren hindurch, dann bringt
ein Musiker von einer Gruppe eine Melodie zu einer anderen und
dieser Klangkörper greift sie auf und führt sie weiter.
Dabei liegt man auf der Wiese und betrachtet die Sterne.
Diese entspannte Haltung, diese weichen Formen
der Bewegung bilden auch einen unterschwelligen Teil in »Air
Borne«, wie ich finde. Daher sind die Ellipsoide auch so
positioniert, dass man die Wege verlassen muss und immer in eine
leicht kurvende Bewegung gebracht wird, um die Texte zu lesen
und so in bestimmte Bildpositionen gerät, die mit der Musik
eine Übereinstimmung haben. Das ist vom Raum und vom Bildnerischen
gedacht und hat doch fast etwas Choreografisches, diese Bewegungen
der Menschen auf der Wiese.
Amonat: Wie
bist du auf die Form der Ellipsoide gekommen?
Krüskemper: Meine Überlegungen
reichten zunächst von nicht sichtbaren Lautsprechern bis
hin zu visuell sehr präsenten Objekten. Die Lösung
war dann eine Form, die sehr offensichtlich ein Klangkörper
ist. Ich erinnere nur an die Kugellautsprecher der siebziger
Jahre, die ja aus der Idee entstanden, den Klangwellenverlauf
als Form nachzubilden. Diese Freude am Technischen ist ein Aspekt.
Aber diese Ellipsoide empfinde ich auch als sehr aerodynamisch.
Amonat: Sie
erinnern mich an die Form unbekannter Flugobjekte, die aus der
Vergangenheit kommend gelandet sind, um uns etwas zu erzählen.
Krüskemper: Ja,
sehr passend. Eine Assoziation, die ich mag. Ihre Proportionen
entstanden aus der Überlegung, wie ich mich mit meinem menschlichen
Maßstab dazu in Beziehung bringe, beim Drumherumgehen,
beim Anlehnen auf der Wiese. Kann ich darauf sitzen? Gar drauf
springen? Oder lasse ich es lieber, weil ich offensichtlich dabei
abrutschen würde? Obendrauf ist jedenfalls ein Edelstahlkopf,
in den die Texte eingraviert sind. Zum Teil aus Graffitischutzgründen,
aber eben auch als historischer Bezug: In der Anfangsphase wurden
auf dem Flughafenareal Johannisthal an Stellen, wo Menschen beim
Absturz ums Leben kamen, Metallplaketten als Erinnerung in den
Boden eingelassen.
Amonat: Karlheinz
hat vorhin erzählt, dass das Kind im Mutterleib als erstes
hört und sich erst nach der Geburt das Sehen ausbildet.
Wenn ich mir einen Film mit geschlossenen Augen »anschaue«,
kann ich durch die Filmmusik Szenen als besonders bedrohlich
oder aber als glückselig empfinden. Interessant wird es,
wenn die Musikbegleitung nicht empirisch eingesetzt ist, sich
also eine Szene auf einem Klangteppich bewegt, die aufgrund meiner
Erfahrung mit diesem nicht emotional übereinstimmt. Wenn
ich dies sehend verfolge, kann ich mir gut vorstellen, dass der
Klang stark genug ist, um das visuelle Bild zu beeinflussen.
Das heißt, dieselbe Szene mit einer anderen Musik kann
mir das genaue Gegenteil suggerieren. Es scheint, als ob ein
größeres Vertrauen in der akustischen Wahrnehmung
vorhanden ist.
Krüskemper: Mir
fällt eine Szene in Tarkovskijs »Stalker« ein,
wo die Protagonisten mit der Draisine in die verbotene Zone fahren.
Es ist über lange Zeit ausschließlich ein monotones
Rattern zu hören, eigentlich eher ein nervtötendes
Außengeräusch, aber es hat die Wirkung, während
der Fahrt zu etwas Drängendem, Metaphysischen zu werden,
das letztlich in einen meditativen Trancezustand hinüberführt,
in eine andere Realität. Dabei mischen sich ganz fein Quietschgeräusche
der Schienen unter, die zu dieser eindringlichen Dramaturgie
beitragen. Hier wird – wie in »Air Borne« auch – der
untergegangenen industriellen Arbeitswelt ein neuer Soundtrack
unterlegt. Das ist schon in einem gesellschaftlichen Sinn symbolisch.
Amonat: Das
ist eine unglaublich lange Einstellung. Der ganze Film läuft
ja eigentlich in Echtzeit ab. Der Rhythmus des Alltags ist sowieso
ein vollkommen anderer als der mediale Rhythmus. Aber dieser
hat sich auch verändert. Da braucht man sich nur ältere
Filme anzuschauen, keine Filmkunstwerke, sondern den ganz banalen
Fernsehfilm. Das wirkt heute richtig einschläfernd. Und
das wiederum zeigt, dass auch unser Alltag an Tempo zugelegt
hat. Es scheint so, als ob die mediale Wirklichkeit als Taktgeber
die täglichen Akkorde schneller anschlägt, damit wir
uns nicht langweilen. Und fast unbemerkt und nebenbei erhöhen
wir unsere eigenen Frequenzen. Bewusst wird das nur in der zeitlichen
Differenz. Da erscheint »Air Borne« wirklich wie
ein UFO aus ferner Zeit, mit einem Rhythmus, der uns schon lange
nicht mehr umgibt.
Krüskemper: Das
finde ich einen sehr schönen Gedanken.
Amonat: Ich
kann mir für diese Arbeit pro Semester einen konzertanten
Rahmen vorstellen, ein bewusst erlebtes Konzert mit aufgestellten
Stühlen und so weiter. Alle Umgebungsgeräusche innerhalb
dieser Stunde sind integraler Bestandteil des Konzerts und verweben
sich mit der zufallsgenerierten Komposition der 15 Ellipsoide.
Und wenn nur sehr wenig zu hören ist und die Stille dominiert,
dann sollte es so sein, was ich allerdings nicht glaube. Das
ist nur eine Frage der eigenen Sensorik. Dies wären dann
alles Uraufführungen; kein Konzert gliche dem anderen. Man
könnte solch ein »Konzert« auf einen Termin
nahe dem Semesterauftakt legen: Die Studenten begrüßen
ihren Studienort, indem sie ihm zuhören. Das wäre doch
ein schöner Einstieg. Und ein gelungenes Beispiel integrativer
Kunst.
|