
Kunst bist du!
Dr.
Peter Funken
Der Text beschreibt
Stefan Krüskempers Gestaltungen für die Zürich-Schule
in Berlin-Neukölln und erschien in der gleichnamigen
Publikation »Ene, mene, muh, und Kunst bist du!« zum
Kunst-am-Bau Projekt (2010).
Kunst
vor Ort
Helga
de la Motte-Haber
Den Katalogbeitrag
schrieb Helga de la Motte-Haber anlässlich der Fertigstellung
der Klanginstallation AIR BORNE. Erschienen ist der Text
in der Publikation »AIR BORNE« im verlag für
integrative kunst, 2006.
Philosophischer
Parkspaziergang
Reinhard
Knodt
Der City-Point
wäre schlecht verstanden und verkürzt begriffen,
wenn wir ihn einfach als Einkaufsparadies bezeichnen
würden. Er ist viel mehr, und man versteht unsere
Zeit nicht, wenn man sich nicht - kunstgestützt, wie wir das hier jetzt
versuchen wollen, ein paar Gedanken über
seine Herkunft macht (2005).

Bürger
machen Kunst
Stefan Krüskemper, María
Linares, Kerstin Polzin
Die Citizen Art Days 2012 zeigten
deutlich, wie viele Menschen das starke Bedürfnis haben,
zu den Fragen ihrer Stadt bzw. dem öffentlichen Raum über
Teilhabe, Differenz und Miteinander zu arbeiten.
Wie
die Kunst die Bürger
gewann
Stefan Krüskemper
Bericht über
einen experimentellen Workshop in Berlin zum Verhältnis der Beteiligten
bei der Umsetzung von Kunst im öffentlichen Raum publiziert in »kunststadt
stadtkunst« Heft 57, 2010.
Public
Art Practice in Berlin
Christina
Lanzl
Berlin ranks high
among the world’s urban centers. What makes this
city so special, so worth living in or visiting? Perhaps
it is the rewarding experience of feeling a sense of
place ... (2009).
Mit
Sprachsinn und Raumverstand
Stefan Krüskemper,
Der Artikel erschien
2009 in der Berliner Zeitschrift für Kunst im Öffentlichen
Raum »Kunststadt - Stadtkunst«, Heft 56. Ausführlich
beschrieben ist das Wettbewerbsverfahren und die Jurysitzung
zur Kunst am Bau für das Carl Gustav Carus Universitätsklinikum
in Dresden.
Kunst
als Kompromiss
Stefan Krüskemper, Patricia
Pisani
Fokus dieses Texts
ist die Jurysitzung eines Kunstwettbewerbs in Berlin,
die durch den Konflikt zwischen Nutzern und Fachpreisrichtern
viele generelle Fragen aufwarf. Erschienen ist der
Artikel in der Zeitschrift
über Kunst im Öffentlichen Raum »Kunststadt
- Stadtkunst«, Ausgabe 55, 2008.
Keine
einfache Rechenaufgabe
Martin
Schönfeld
Kunst für
einen Universitätsstandort zu entwickeln, gehört
zu den sehr attraktiven Aufgaben der Kunst im öffentlichen
Raum. Erschienen ist der Artikel in der Zeitschrift
über Kunst im Öffentlichen Raum »Kunststadt
- Stadtkunst«, Ausgabe 53, 2006.

Wo
kommt eigentlich die Kunst her?
Maria Linares, Stefan Krüskemper
Maria Linarres im Gespräch
mit Stefan Krüskemper über den Begriff der Partizipation
und Emanzipation. Erschienen ist der Text in »Ene,
mene, muh, und Kunst bist du!« (2010).
AIR
BORNE
Jörg Amonat,
Karlheinz Essl, Stefan Krüskemper
Während der Realisierungsphase
der Klanginstallation im Aerodynamischen Park in Berlin
Adlershof wurde das Gespräch der Künstler aufgenommen
und transkribiert. Erschienen ist der Text in der Publikation »AIR
BORNE« im verlag für integrative kunst, 2006.
Alles
im grünen Bereich
Jörg Amonat,
Stefan Krüskemper, Michael Schneider, Johannes
Volkmann
Ein Gespräch
zwischen Michael Schneider und dem buero für integrative
kunst über die Umsetzung des Projekts »parkTV« vor
Ort. Erschienen ist der Text in der Publikation »parkTV
- Alles im grünen Bereich« im verlag für
integrative kunst, 2005.
Heute
ist ein schöner Tag
Jörg Amonat, Anne Eberle,
Stefan Krüskemper
Das Interview mit
der Erwerbslosen Anne Eberle entstand für die Ausstellung »Science
+ Fiction« auf Einladung der Künstler Dellbrügge
und de Moll für ihre Wissens-Installation »Wild
Cards«, 2003.
Positionen
und Tendenzen
Christina Jacoby, Stefan Krüskemper,
Heidi Sadlowski
Auszug aus einem Interview
von Christina Jacoby mit Heidi Sadlowski und Stefan Krüskemper
zu ihrem Projekt »Arbeit über Arbeit«.
Erschienen ist der Text in der Publikation »Positionen
und Tendenzen - goes public«, 2001 im Verlag für
moderne Kunst, 2001.

Politische
Aspekte von Kunst im urbanen Raum
Stefan Krüskemper
Der Vortrag war
am 5. Februar 2009 im Haus Huth der Daimler Contemporary
im Rahmen der Veranstaltung »Vom Reiterstandbild
zum Graffiti« zu hören. Beleuchtet wurde an
diesem Abend die Entwicklung der Kunst im öffentlichen
Raum unter dem Aspekt ihrer politischen Aussagefähigkeit
und Wirkungsfähigkeit.
Kunst
im öffentlichen Raum
Dr.
Anne Marie Freybourg
Zur Eröffnung
der Klanginstallation
»AIR BORNE« am 25. Oktober 2006 hielt
Dr. Anne Marie Freybourg als Mitglied der Jury die
nachfolgende Rede.

Der
Traum vom Raum
Stefan Krüskemper
Während eines
Arbeitsaufenthalts in der Galerie »Autocenter« (Lovelite)
in Berlin Friedrichshain entstand dieses Essay über
die Kommerzialisierung von Stadt und ihren neuen Tempeln,
den Einkaufsmalls. Erschienen ist der Text in der Publikation »parkTV« im
verlag für integrative kunst, 2005.
The
Matrix has you
Stefan Krüskemper
Das Essay ist
ein Resümee des Projektes »Arbeit über
Arbeit«, zu dem Soziologen, Philosophen und Künstler
eingeladen waren, um über einen heutigen Arbeitsbegriff
zu diskutieren. Erschienen ist der Text in den Publikationen »Arbeit über
Arbeit«, 2001 und »Log.in - Netz, Kunst,
Werke« im Verlag für moderne Kunst, 2001.

Tätig
werden. Ein Spiel.
Jörg Amonat, Stefan
Krüskemper
Das Experiment einer
direkten Umsetzung eines dokumentarischen Videos in eine
Print-Publikation, zeigt der Beitrag für das Buch »Arbeit
und Rhythmus«. Das Buch erschien im Wilhelm Fink
Verlag München, 2009.
Team
Fiction
Stefan Krüskemper
Der Text ist gleichzeitig
Reisebericht und Textvorlage für die gleichnamige
Theaterperformance, die in Cali und Berlin aufgeführt
wurde. Erschienen ist das Stück in Gesprächsform
in der Publikation »The Intricate Journey« im
Verlag der Neuen Gesellschaft für Bildende Kunst,
2007.
Arbeit
simulieren
Stefan Krüskemper
Diese Textarbeiten
stehen stellvertretend für eine Reihe Miniaturen mit
besonderen Formen der Veröffentlichung. In knappester
Form vermitteln diese Sätze Erkenntnis über eine
komplexe Fragestellung. Erschienen sind diese Textarbeiten
in der Ausstellung »KunstRaumFranken« im Kunsthaus
Nürnberg als Leuchtkästen, 2001.
|
The Matrix
has you
Stefan Krüskemper
»Man muß sich
in der Mentalität aus der Arbeitsgesellschaft
als einziger Form der Gesellschaft zurückziehen:
Das nenne ich den Exodus. Der erste Akt jeder politischen
Veränderung, jeder gesellschaftlichen Umwälzung,
ist eine kulturelle Veränderung. Die erste
Aufgabe ist die Entwicklung der Subjektivität:
Die Herstellung neuer Formen der Geselligkeit,
die weder auf den Warentausch noch auf den Verkauf
der Arbeitskraft gegründet sind.« 1
Massenintellektuelle: Netzwesen die
in Städten umherschweifen um flüchtige Verbindungen
einzugehen – eine Arbeitsgruppe, ein Job, ein neues Projekt.
Anzubieten haben sie eines, ihre Subjektivität. Ihre Haltung
und ihre Fähigkeit zur Kommunikation. Flexibel unterbieten
sie im Gespräch den Preis der KonkurrentInnen oder drücken
den ihrer KooperationspartnerInnen um ihre Idee zu realisieren.
Das Produkt ist die (Um-) Wertung einer gesellschaftlichen Relation
und der Preis, den sie bezahlen, ist die Erosion ihrer persönlichen
Lebensbereiche durch die Totalität der Arbeit und die Monetarisierung
Ihrer Beziehungen. Zerrissen von der Erschöpfung ihrer selbstausbeuterischen
Unternehmung und der Euphorie der neuen Arbeitsgruppe folgen
sie ihrem calling in die sich konturierende Matrix der postfordistischen »Kommunikationsökonomie«.
Immaterielle
Arbeit in der Kommunikationsökonomie
Diese Matrix autonomer Subjekte fordert eine völlig andere
Lebensweise als die auf »Vollerwerb« begründete
industrielle Existenz mit ihren Dichotomien aus Arbeit – Freizeit
und Produktion – Konsumption. Denn zentrales Tool der immateriellen
Arbeit des Massenintellektuellen ist die Ausdehnung der produktiven
Kooperation und damit der Reproduktion der Kommunikation. Mehr
noch: beginnt der Produktionsprozess der Kommunikation unmittelbar
zum Verwertungsprozess zu werden, so daß die einst passiven
KonsumentInnen vom ersten Moment an in die Ökonomie der
Matrix einbezogen sind. Maurizio Lazzerato 2 schreibt: »Im
Gegenteil wird der Konsumptionsakt produktiv, insofern er notwendige
Bedingung neuer Produkte ist. Konsumption ist infolgedessen vor
allem Konsumption von Informationen. Sie ist nicht länger
blosse Realisierung eines Produkts, sondern der reale gesellschaftliche
Prozess im eigentlichen Sinn, der für den Augenblick als
Kommunikation definiert ist.« Das Bewerten und sich Informieren
der Konsumenten genauso wie das Position beziehen und das Veröffentlichen
der Produzenten sind die Bindungen innerhalb der Matrix, die
diesen gesellschaftlichen Prozess, gleich einer in die Gesellschaft
eingeschriebenen Fabrik, etablieren.
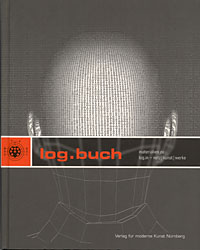 |
Erschienen in
: log.buch - netz/kunst/werke, Verlag für
moderne Kunst, Nürnberg 2001.
ISBN 3-933096-40-5
|
Das Produkt immaterieller Arbeit
ist die »Message« und ihre diskursive Positionierung
in der Matrix. Eine solche öffentliche Relation als Prozess
wird dann existent und produktiv, wenn sie Aufmerksamkeit gefunden
hat. So beschreibt Michael Goldhaber 3 im Internetmagazin Telepolis
die knappe Ressource der Aufmerksamkeit als eine neue und eigenständige ökonomische
Form. Die Positionierung einer gesellschaftlichen Relation benötigt
in der Kommunikationsökonomie einen Informationsträger,
der die immateriellen Produkte kapitalistisch vermarktbar und verwertbar
macht. Aber: Wie bestimmt sich der Wert einer Ware, wenn das materielle
Medium in den Hintergrund tritt und sich der Grad der Autonomie
einer Tätigkeit, und damit der Subjektivität der ProduzentInnen, über
diesen Hintergrund definiert.
Der
Wert der Arbeit im Akt der Konsumption
Martin Burckhardt, Audiokünstler und Medientheoretiker,
nannte seine (Mehr-)Werttheorie im Interview 4 »Psychologistik«.
Früher war der Artefakt selbst selten, der
kunstvolle Tisch, der besondere Stuhl. Diese Seltenheit
und die Logistik des Transports von A nach B bestimmten
seinen Wert. In der Zeit der mechanisch reproduzierbaren
Artefakte ist die Seltenheit in den Akt der Konsumption übergegangen. »Weil
ich es erlebe!« bekommt etwas seinen Wert.
Immaterielle Arbeit wird durch den Akt der Konsumption
der Aufmerksam-gewordenen valorisiert.
Das digitale Prinzip der »Psychologistik« in
der Kommunikationsökonomie spüren paradigmatisch die
Teleexistenzen des Wirtschaftsraums Internet, denn dort ist die
Verlagerung von der industriellen Produktion zur kulturellen
Projektion, die Waren nunmehr im »Kopf« von A nach
B schafft, vollzogen. Durch den Download, das verschieben einer
Ware in real time und durch die psychologischen Gesetzen folgende
Perzeption, erhält die damit verbundene Arbeit ihren Wert.
Die Kategorien Passivität und Aktivität weichen im
Internet einem allgemeinen Produktionsprozess der Kommunikation.
Der »Wertproduzent« informiert sich entspannt zu
hause am PC, um daraufhin als »Warenproduzent« öffentlich
Position zu beziehen.
Die Bewertung ist in der Gesamtheit
an die Masse übergegangen. Konkrete ökonomische Ansätze
dieser neuen Form der Wertschöpfung finden sich im Internet
in Form der beenz - Währung. 5 Das Interesse der KonsumentInnen
an einer Website wird quantifiziert und bewertet. Sein/ihr Verhalten,
das Verweilen und Klicken, eben die Aufmerksamkeit, wandelt sich
zu einem Kontowert in beenz, der in diesem System an anderer
Stelle, besser: anderer url, wieder ausgegeben werden kann. Ein
ungelenker und konstruierter Versuch ein Konsumptionsentgelt
zu etablieren (und Werbekulis loszuwerden). Die Teilnahme an
dem sozialen Prozess der Kommunikation kann nicht wirklich kommerziell
quantifiziert werden, da es sich eben um einen kulturellen Projektionsprozess
handelt, der allgemeinen gesellschaftlichen Wert produziert.
Relation.
Nach der
industriellen Produktion: die kulturelle Projektion
Ein Beispiel einer Unternehmung, dessen Werte schon Konzepte,
Ideen und Bilder sind, zitiert Jeremy Rifkin. »In der neuen
Wirtschaft will jedes Unternehmen wie Nike sein. Diese Firma
hat keine eigenen Werke und wenig materielle Wirtschaftsgüter.
Ihre Schuhe werden von anonymen Subunternehmern in Südostasien
gefertigt. Nike ist ein Designstudio mit einem starken Markennamen
und einem leistungsfähigen Marketing- und Vertriebsnetz.
Das Unternehmen verkauft zwar noch Schuhe auf traditionellen
Märkten, organisiert seine internen Geschäftsprozesse
aber über b2b-netzwerke (business-to-business gliedert ganze
Prozessketten aus, Anm. des Verf.) mit Lieferanten rund um die
Welt. Nikes eigentliches Kapital ist das Image, mit dem es die
Schuhe umgibt. Wenn ein Kind mehr als 200.- DM für Nike-Schuhe
ausgibt, zahlt es in Wirklichkeit dafür die Nike-Story zu
erleben«. 6
Wenn das Produkt einer Unternehmung
zur kulturellen Projektion wird, liegt es nahe: Kultur und Wirtschaft,
Medien und Politik mit dem Selbstunternehmen Kunst in Verbindung
zu bringen. Je mehr sich die alte Erwerbsarbeit den kulturellen
Produktionsmechanismen immaterieller Arbeit annähert, desto
schärfer bildet sich das strukturale Defizit der »human
ressource« in noch hierarchischen Firmenstrukturen ab.
Und so mehren sich die Beiträge, die den Künstler und
die Künstlerin als klassischen Typus des immateriellen Produzenten
ausmachen und sie als Vorreiter des flexiblen und kreativen Netzwesens,
das seine Vermarktung und finanzielle Situation selbst regelt,
stilisieren. Denn »Dieses dem heutigen Bewusstsein noch
sehr ungewohnte Handeln (...) ist vorgebildet im künstlerischen
Prozess. Im künstlerischen Handeln kann man daher urbildhaft
genau die Vorgehensweise finden, die heute in Wirtschaft und
Arbeitswelt mehr und mehr verlangt wird. In diesem Sinne werden
dort überall Arbeiten und wirtschaftliches Handeln zur Kunst.
Der kundenorientierte Verkäufer ist, so gesehen, ebenso
ein Künstler, wie der Manager oder Vorgesetzte zum Künstler
werden muß (...). Von ihnen allen wird künstlerisches
Handeln verlangt.« formulierte der Soziologe Michael Brater7
. Die Drohung der Beuysschen Verheissung – Alles wird Kunst?
Die Simulation
des Lebens in der Kunst
Existenzangst, Verinnerlichung des kapitalistischen Leistungsdenkens
und Illoyalität im sozialen Verhalten sind die heutigen
Erscheinungen und Stressfaktoren 8 der Selbstunternehmung im
Kunstkontext. Gelingt einigen die inhaltliche und finanzielle
Verwirklichung ihrer individualisierten Arbeit, bleiben die meisten
in prekären Beschäftigungsverhältnissen stecken.
The winner takes it all. Fatal: steigt die Anzahl schlecht bezahlter Überlebens-Jobs
und die Notwendigkeit persönlicher Absicherungen durch die
Deregulierungen der Sozialverträge. 9 Die, die nicht aufgeben
stellen beizeiten verblüfft fest, dass ihr Leben´ zur
Simulation geworden ist, in der Aspekte wie Freundschaft und
Familie nunmehr dem Aufrechterhalt eines ökonomisch formulierten
Status quo dienen: der Gleichschaltung ihrer Subjektivität
mit den Anforderungen des Produktionsprozess und seiner unmittelbaren
(reiz-)ökonomischen Verwertbarkeit. Dann doch lieber Kunst´ im
Leben simulieren?
Thomas Röbke der am Nürnberger
Institut für soziale und kulturelle Arbeit tätig ist
fordert in »Kunst und Arbeit« von der Politik den
Ausbau eines Netzwerkes zwischen den Fakultäten. Ohne die
Stabilisierung von Netzwerkknoten durch eine gewisse Verbindlichkeit
lasse sich die Selbstorganisation von Kunst nicht mehr aufrechterhalten
und der harte Wettstreit konkurrierender Subjekte und Arbeitsgruppen
nicht entschärfen. Seine Idee: Kunstmuseen sollen zur Kontaktbörse
werden und Praktikumsplätze für Künstler in lokalen
Wirtschaftsunternehmungen vermitteln. Ziel ist die Schaffung
neuer Tätigkeitsfelder für Künstler und ein Kompetenz-
und Kreativitätsaustausch. 10
Der Gefahr einer alles erfassenden Ökonomisierung,
der Simulation von Kunst´ oder Leben´, entgehen Michael
Brater und einige andere Soziologen durch die Forderung nach
einem bedingungslosen Existenzgeld für die Teilnahme am
sozialen Kommunikationsprozess. Konsumptionsentgelt für
Jeden. Konkret schlägt Gorz einen Betrag von 1500.- DM vor,
der durch bezahlte Arbeit allerdings aufgestockt werden kann.
Es gibt
kein Richtig im Falschen
Immaterielle Arbeit wird über das Abstraktum Geld ausgebeutet
und reproduziert das Kapitalverhältnis und damit die bestehende
Struktur des flexiblen Kapitalismus. The matrix has you. Konkret
beschrieb dies Walter Schütz von mannesmann-pilotentwicklung,
der immer wieder auch Künstler und Künstlerinnen für
den dringend benötigten Kreativ-Input in das Unternehmen
einlädt, »wer bei uns als freier Mitarbeiter sein
Know-how eingebracht hat, ist nach dem Projekt – für
das wir ihn einstellten – wirklich aufgebraucht, er hat
seine Kompetenz und Energie bei uns gelassen. Er benötigt
danach eine Phase der Erholung und der Weiterbildung, um auf
dem Arbeitsmarkt wieder interessant zu sein.« 11
Nicht immer drückt sich diese Erkenntnis
in einem entsprechenden Honorar wie bei mannesmann-pilotentwicklung
aus. Wenn dein Subjekt abgeschöpft ist, konstruiere dir
eine neue Identität und bringe sie wieder in die Produktion
ein, lautet allgemeiner der markige Slogan. Der Sozialphilosoph
und Politökonom Robert Kurz beschreibt die heutige Totalität
der Umwandlung menschlicher Arbeit in Energie für die Geldwirtschaft
als »Selbstverbrennung«. Der Funktionszusammenhang,
den das Abstraktum Geld mit der Arbeit eingeht, ist herausgelöst
aus sozialen Lebensbedingungen: eine Verbrennungsmaschine, die
Lebendiges auf Totes reduziert und allenfalls Simulationen von
Lebendigem zurückläßt. Wir werden diese Arbeit
nicht los ohne das Geld loszuwerden! Anders formuliert ist die
Trennung von Geld und Arbeit, milder: die Forderung nach einem
bedingungslosem Existenzgeld, eine emanzipatorische Möglichkeit
des antagonistischen Subjekts in der Matrix der Kommunikationsökonomie.
Subversive
Strategien: Produktiver Müssiggang und neue Formen der
Geselligkeit
In den Grundrissen von Marx findet sich der Begriff des allgemeinen
Wissens einer Gesellschaft, des général intellect.
Andre Gorz schreibt dazu: »In Zeiten des Internet, der
Kybernetik und Informatik, der Vernetzung alles Wissens, wird
vollends sichtbar, daß die Arbeitszeit nicht mehr als Maß der
Arbeit, und die Arbeit nicht als Maß des produzierten Reichtums
dienen kann, weil die unmittelbare Arbeit zum großen Teil
nur noch die materielle Fortsetzung einer immateriellen, intellektuellen
Arbeit, der Reflexion, der Verständigung, des Austauschs
von Informationen, der Verbreitung von Wissen, kurz, des général
intellect, ist. (...) Man muß also Orte zum Leben fordern,
um tätig zu werden und sich auszutauschen, wo die Leute
sowohl Geselligkeit als auch materiellen und immateriellen Reichtum
produzieren können.« 12
Immaterielle Arbeit konstituiert aus
sich heraus unmittelbar kollektive Formen und soziale Kooperationen,
die trotz Unterordnung der »ideologischen« Ware unter
die Logik kapitalistischer Verwertung das Potential der Selbstorganisation
nicht verlieren. 13 Zum anderen: der Inhalt einer gesellschaftlichen
Relation verliert seine spezifischen Eigenheit auch als Ware
nicht. Die beschriebene Matrix immaterieller Arbeit wird aber
da autonom, wo sie sich von kapitalistischen Verwertungsformen
nicht vereinnahmen und repräsentieren lässt. Arbeit
zum produktiven Müßiggang wird und: die Verwertungsmechanismen
reflektiert und beschreibt.
Dennoch. Die Verweigerung der Abstrakten
Verbindung Geld und Arbeit ist dringlich, um neue Formen der
Subjektivität würdevoll leben zu können. Verbindliche
Formen der Geselligkeit und Orte zum Leben, in denen der Erwerb
nicht kapitalisierbarer Fähigkeiten und ein produktiver
Müßiggang die Quelle der eigentlichen Produktivität – des
gesellschaftlichen Kommunikationsprozesses – ist, finden
sich Ansatzweise in politischen Bewegungen, in sozial engagierten
Initiativen oder in wenigen künstlerischen Gemeinschaftsprojekten.
Existenzsicherung in Form eines Konsumptionsentgelts, dessen
Forderung sich aus den beschriebenen kulturellen Veränderungen
ableitet, oder der Schutz eines gruppeninternen Punkte-systems,
wie sie einige autonome Kommunen für sich entwickelt haben,
sind pragmatische (Zukunfts-) Strategien, um sich der »Selbstverbrennung« zu
entziehen. Um wieder zu Arbeiten'.
01 Interview mit André Gorz: »Aktuelles
Elend, möglicher Reichtum«
02 Maurizio Lazzarato: »Immaterielle Arbeit«
03 Telepolis, Michael Goldhaber: »Aufmerksamkeitsökonomie«
04 Projektteil mit Martin Burckhardt: »Immaterielle Produktion«
05 Telepolis: »beenz«
06 Jeremy Rifkin: »Klick den Markt weg«
07 Michael Brater: »Künstlerische Praktiken im Arbeitsprozeß«
08 Projektteil mit Stephan Kurr: »Selbstausbeutung verweigern«
09 WZB Berlin: »Arbeitsmärkte für Publizisten
und Künstler«
10 Thomas Röbke: »Arbeit und Kunst«
11 Projektteil bei Artcircolo und Büro Orange: »postersession«
12 Interview mit André Gorz: »Aktuelles Elend, möglicher
Reichtum«
13 Projektteil mit Claudia Klinger, Ralf Ebbinghaus: »Teleexistenz« |