
Kunst bist du!
Dr.
Peter Funken
Der Text beschreibt
Stefan Krüskempers Gestaltungen für die Zürich-Schule
in Berlin-Neukölln und erschien in der gleichnamigen
Publikation »Ene, mene, muh, und Kunst bist du!« zum
Kunst-am-Bau Projekt (2010).
Kunst
vor Ort
Helga
de la Motte-Haber
Den Katalogbeitrag
schrieb Helga de la Motte-Haber anlässlich der Fertigstellung
der Klanginstallation AIR BORNE. Erschienen ist der Text
in der Publikation »AIR BORNE« im verlag für
integrative kunst, 2006.
Philosophischer
Parkspaziergang
Reinhard
Knodt
Der City-Point
wäre schlecht verstanden und verkürzt begriffen,
wenn wir ihn einfach als Einkaufsparadies bezeichnen
würden. Er ist viel mehr, und man versteht unsere
Zeit nicht, wenn man sich nicht - kunstgestützt, wie wir das hier jetzt
versuchen wollen, ein paar Gedanken über
seine Herkunft macht (2005).

Bürger
machen Kunst
Stefan Krüskemper, María
Linares, Kerstin Polzin
Die Citizen Art Days 2012 zeigten
deutlich, wie viele Menschen das starke Bedürfnis haben,
zu den Fragen ihrer Stadt bzw. dem öffentlichen Raum über
Teilhabe, Differenz und Miteinander zu arbeiten.
Wie
die Kunst die Bürger
gewann
Stefan Krüskemper
Bericht über
einen experimentellen Workshop in Berlin zum Verhältnis der Beteiligten
bei der Umsetzung von Kunst im öffentlichen Raum publiziert in »kunststadt
stadtkunst« Heft 57, 2010.
Public
Art Practice in Berlin
Christina
Lanzl
Berlin ranks high
among the world’s urban centers. What makes this
city so special, so worth living in or visiting? Perhaps
it is the rewarding experience of feeling a sense of
place ... (2009).
Mit
Sprachsinn und Raumverstand
Stefan Krüskemper,
Der Artikel erschien
2009 in der Berliner Zeitschrift für Kunst im Öffentlichen
Raum »Kunststadt - Stadtkunst«, Heft 56. Ausführlich
beschrieben ist das Wettbewerbsverfahren und die Jurysitzung
zur Kunst am Bau für das Carl Gustav Carus Universitätsklinikum
in Dresden.
Kunst
als Kompromiss
Stefan Krüskemper, Patricia
Pisani
Fokus dieses Texts
ist die Jurysitzung eines Kunstwettbewerbs in Berlin,
die durch den Konflikt zwischen Nutzern und Fachpreisrichtern
viele generelle Fragen aufwarf. Erschienen ist der
Artikel in der Zeitschrift
über Kunst im Öffentlichen Raum »Kunststadt
- Stadtkunst«, Ausgabe 55, 2008.
Keine
einfache Rechenaufgabe
Martin
Schönfeld
Kunst für
einen Universitätsstandort zu entwickeln, gehört
zu den sehr attraktiven Aufgaben der Kunst im öffentlichen
Raum. Erschienen ist der Artikel in der Zeitschrift
über Kunst im Öffentlichen Raum »Kunststadt
- Stadtkunst«, Ausgabe 53, 2006.

Wo
kommt eigentlich die Kunst her?
Maria Linares, Stefan Krüskemper
Maria Linarres im Gespräch
mit Stefan Krüskemper über den Begriff der Partizipation
und Emanzipation. Erschienen ist der Text in »Ene,
mene, muh, und Kunst bist du!« (2010).
AIR
BORNE
Jörg Amonat,
Karlheinz Essl, Stefan Krüskemper
Während der Realisierungsphase
der Klanginstallation im Aerodynamischen Park in Berlin
Adlershof wurde das Gespräch der Künstler aufgenommen
und transkribiert. Erschienen ist der Text in der Publikation »AIR
BORNE« im verlag für integrative kunst, 2006.
Alles
im grünen Bereich
Jörg Amonat,
Stefan Krüskemper, Michael Schneider, Johannes
Volkmann
Ein Gespräch
zwischen Michael Schneider und dem buero für integrative
kunst über die Umsetzung des Projekts »parkTV« vor
Ort. Erschienen ist der Text in der Publikation »parkTV
- Alles im grünen Bereich« im verlag für
integrative kunst, 2005.
Heute
ist ein schöner Tag
Jörg Amonat, Anne Eberle,
Stefan Krüskemper
Das Interview mit
der Erwerbslosen Anne Eberle entstand für die Ausstellung »Science
+ Fiction« auf Einladung der Künstler Dellbrügge
und de Moll für ihre Wissens-Installation »Wild
Cards«, 2003.
Positionen
und Tendenzen
Christina Jacoby, Stefan Krüskemper,
Heidi Sadlowski
Auszug aus einem Interview
von Christina Jacoby mit Heidi Sadlowski und Stefan Krüskemper
zu ihrem Projekt »Arbeit über Arbeit«.
Erschienen ist der Text in der Publikation »Positionen
und Tendenzen - goes public«, 2001 im Verlag für
moderne Kunst, 2001.

Politische
Aspekte von Kunst im urbanen Raum
Stefan Krüskemper
Der Vortrag war
am 5. Februar 2009 im Haus Huth der Daimler Contemporary
im Rahmen der Veranstaltung »Vom Reiterstandbild
zum Graffiti« zu hören. Beleuchtet wurde an
diesem Abend die Entwicklung der Kunst im öffentlichen
Raum unter dem Aspekt ihrer politischen Aussagefähigkeit
und Wirkungsfähigkeit.
Kunst
im öffentlichen Raum
Dr.
Anne Marie Freybourg
Zur Eröffnung
der Klanginstallation
»AIR BORNE« am 25. Oktober 2006 hielt
Dr. Anne Marie Freybourg als Mitglied der Jury die
nachfolgende Rede.

Der
Traum vom Raum
Stefan Krüskemper
Während eines
Arbeitsaufenthalts in der Galerie »Autocenter« (Lovelite)
in Berlin Friedrichshain entstand dieses Essay über
die Kommerzialisierung von Stadt und ihren neuen Tempeln,
den Einkaufsmalls. Erschienen ist der Text in der Publikation »parkTV« im
verlag für integrative kunst, 2005.
The
Matrix has you
Stefan Krüskemper
Das Essay ist
ein Resümee des Projektes »Arbeit über
Arbeit«, zu dem Soziologen, Philosophen und Künstler
eingeladen waren, um über einen heutigen Arbeitsbegriff
zu diskutieren. Erschienen ist der Text in den Publikationen »Arbeit über
Arbeit«, 2001 und »Log.in - Netz, Kunst,
Werke« im Verlag für moderne Kunst, 2001.

Tätig
werden. Ein Spiel.
Jörg Amonat, Stefan
Krüskemper
Das Experiment einer
direkten Umsetzung eines dokumentarischen Videos in eine
Print-Publikation, zeigt der Beitrag für das Buch »Arbeit
und Rhythmus«. Das Buch erschien im Wilhelm Fink
Verlag München, 2009.
Team
Fiction
Stefan Krüskemper
Der Text ist gleichzeitig
Reisebericht und Textvorlage für die gleichnamige
Theaterperformance, die in Cali und Berlin aufgeführt
wurde. Erschienen ist das Stück in Gesprächsform
in der Publikation »The Intricate Journey« im
Verlag der Neuen Gesellschaft für Bildende Kunst,
2007.
Arbeit
simulieren
Stefan Krüskemper
Diese Textarbeiten
stehen stellvertretend für eine Reihe Miniaturen mit
besonderen Formen der Veröffentlichung. In knappester
Form vermitteln diese Sätze Erkenntnis über eine
komplexe Fragestellung. Erschienen sind diese Textarbeiten
in der Ausstellung »KunstRaumFranken« im Kunsthaus
Nürnberg als Leuchtkästen, 2001.
|
Kunst
vor Ort
Helga de la Motte-Haber
Kunst im öffentlichen Raum, sei
es ein schön geschmückter Brunnen oder ein majestätisches
Reiterstandbild, prägt schon seit Jahrhunderten Stadtlandschaften.
Auch Kunst als öffentlich gestalteter Raum, so zum Beispiel
die Gartenarchitektur, kann auf eine lange Tradition zurückblicken.
Seit einigen Jahrzehnten haben jedoch
Durchgangsorte, Plätze, die zum Überqueren gedacht
sind, das Interesse von Künstlern auf sich gezogen. Environments
und Installationen, die zum Verweilen einladen, verleihen ihnen
den Charakter von Kunst als öffentlichem Raum. Sie überformen
einen Ort, sind jedoch nicht beliebig hinzugefügt, sondern
spezifisch auf ihre Umgebung bezogen. Der Ort selbst wird Teil
der künstlerischen Gestaltung. Herkömmliche ästhetische
Kategorien gewinnen dadurch eine neue Dimension, weil sie nicht
mehr einem autonomen künstlerischen Objekt zugeschrieben
werden können. Was als authentisch erfahren wird, ist in
eine umfassende Interpretation der räumlichen Disposition
eingebettet. Bilder können von einem Museum an ein anderes
verliehen werden, Musik kann in verschiedenen Sälen gespielt
werden. Ortsspezifische Kunst hingegen ist einmalig an ein Hier
der Erfahrung des Rezipienten gebunde.
Oft handelt es sich um multisensorische
Setzungen, so etwa, wenn eine visuelle Gestaltung mit Hörereignissen
verbunden wird. Denn mit Klängen lassen sich Atmosphären
emotional verdichten. Das Auge distanziert, es erlaubt den eigenen
Standort abzuschätzen; die »Eindringlichkeit« des
Ohres hingegen intensiviert die partizipatorischen Prozesse des
Besuchers. Ortsspezifische Installationen thematisieren stärker
als traditionelle Kunst die Wahrnehmung des Rezipienten.
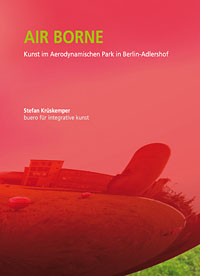 |
Erschienen in: Air Borne, verlag
für integrative kunst, Berlin 2006.
ISBN-10: 3-00-018996-3
|
Um einem Ort gerecht zu werden, der
einmal entscheidend von seiner Geräuschkulisse geprägt
wurde, spielte die Idee, mit Klang zu arbeiten, für den
von der Architektur herkommenden Künstler Stefan Krüskemper
eine große Rolle. Für die Neukonzeption der Wiesenfläche
des Aerodynamischen Parks in Berlin-Adlershof – dem Gelände,
auf dem 1909 der erste Motorflughafen Deutschlands eröffnet
wurde – lud Krüskemper den Wiener Komponisten Karlheinz
Essl ein, erprobt in allen musikalischen Gattungen, auch elektroakustischer
Musik und Klanginstallation, und entwickelte in der Zusammenarbeit
mit ihm eine Lösung, bei der visuelle und akustische Komponenten
eng miteinander verbunden werden.
Die 15 roten ellipsenförmigen und
60 Zentimeter hohen Gebilde, die wie Markierungen über die
Fläche verteilt sind, wirken geheimnisvoll abstrakt und
schaffen Aufmerksamkeit für die umgebenden Baudenkmale der
Luftfahrt wie auch für die Gebäude, die im Lauf der
Zeit neu hinzukamen. Sind es Boviste, die aus der Wiese sprießen
und anstelle von Samenstaub Klang in ihre Umgebung zerstäuben?
Oder sind es Flugkörper von Außerirdischen, die in
ihrem Inneren flüstern? Funktional gesehen handelt es sich
um stabile Lautsprechergehäuse, die den roten Kugellautsprechern
der französischen akusmatischen Musik verwandt sind. Sie
verweisen nicht nur auf die Bauwerke des Ortes; sie laden durch
eingravierte doppelsinnige Texte zum Verweilen ein, die sich
einerseits auf verschiedene Aspekte der Luftfahrt beziehen und
andererseits zur Reflexion des eigenen Selbst auffordern: »Im
Fluge sein. Mut wie Luft.« Diese Inschriften schweben jeweils
wie ein Motto über den Klängen, bearbeiteten historischen
Aufnahmen des Deutschen Rundfunkarchivs, die aus ihrem Inneren
dringen. In den oft langen Pausen zwischen den Klängen werden
die heutigen Geräusche des Platzes zum Sprechen gebracht.
Mehr als bei anderen Klanginstallationen
handelt es sich hier um einen Umgang mit Klang und Zeit, der
im Sinne des erweiterten Kompositionsbegriffs, den das 20. Jahrhundert
hervorgebracht hat, den schwierigen Balanceakt zwischen strenger
Konstruktion und überraschendem Zufall wagt. Die Granularsynthese,
der das Archivmaterial unterworfen wird, das heißt die
Zerstückelung eines Klangs in ein Granulat, dessen »Körner« sich
durch Zufallsoperationen neu mischen, zeigt jene Kontrolle über
das Unkontrollierbare, die einerseits größtmögliche
Homogenität des Klanggeschehens (alles aus einer Quelle)
bei andererseits maximaler Variabilität (unendlich viele
Permutationen) bewirkt. Zusätzlich wurden die komplizierten
Zufallsprozesse in der Software von Karlheinz Essl so programmiert,
dass fließende, musikalische Übergange entstehen können.
Wer sich »luftgetragen« und
lustgetragen durch diese Installation bewegt, wird in eine Szenerie
versetzt und zum Mitspieler erhoben. Da die Textgravuren halbkreisförmig
auf den roten Ellipsoiden angebracht sind, muss man um diese
herumwandern, um sie zu lesen. Bis zu einem Abstand von wenigen
Metern erinnert der Klang an das jeweilige Motto. Wenn die Lautsprecherklänge
pausieren, findet eine Art Verwandlung statt: Man wird auf Höhe
der akustischen Atmosphäre des Realraums erhoben.
Mögen auch die Wege durch die Gruppierung
der Ellipsoide wie durch Meilensteine markiert sein, so sind
sie doch individuell wählbar – und mit ihnen der Bedeutungsraum,
den man sich aneignen kann. Die 15 gravierten Texte lassen sich
in drei mal fünf Stationen einteilen: Flug – Höhe – Mut
/ Boden – Erde – zerbrechen / Strömung und Druck – nachgeben – nicht
nachgeben. Der Besucher schafft im Umhergehen, Übergehen
und Verweilen seine je eigene Geschichte, auch wenn ihn ab und
an ein kurzes lautes Signal inmitten der meist leise flüsternden
und sprechenden roten Körper aus seinen Gedanken reißt.
Kunst vor Ort besitzt keinen institutionellen
Rahmen, wie er für die traditionelle Kunst durch Museen
und Konzertsäle gegeben ist. Wer zufällig in ein solches
Environment gerät, wird kommunikativ einbezogen, ohne genau
zu wissen, in welchen Bedeutungsraum er eingetreten ist. Es ist
sehr selten, dass die zwangsläufig ausgelösten Orientierungsreaktionen
des Besuchers von den Künstlern mitbedacht werden. Anders
bei AIR BORNE, wo die Vermittlung an das Publikum von vornherein
durch eine Publikation und eine Website, die das Projekt begleiten,
eingeplant wurde. Ein Rahmen wurde damit geschaffen, der es ermöglicht,
den unmittelbaren emotionalen Eindruck der Installation durch
kognitives Wissen zu erweitern. |